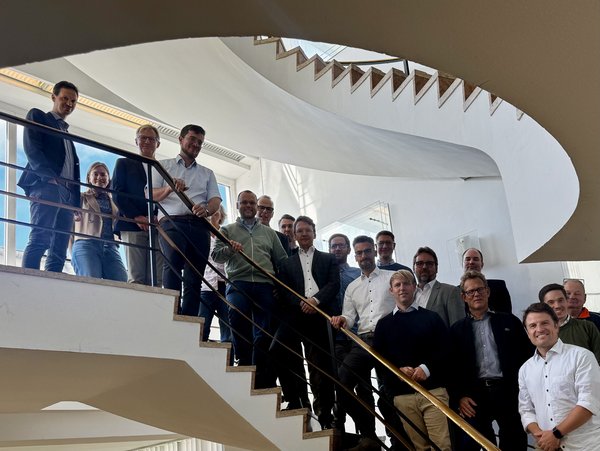Zukunftsperspektive Kohlenstoffdioxid
Studie erarbeitet Kosten und Rahmenbedingungen für eine CO2-Infrastruktur bis zur Nordsee
In vielen Unternehmen Deutschlands entsteht Kohlenstoffdioxid (CO₂). Es wird normalerweise nicht weiterverwertet oder gespeichert, sondern an die Umwelt abgegeben. Dort wirkt es klimaschädlich. Eine gerade gestartete Studie befasst sich nun mit den Möglichkeiten einer CO₂-Infrastruktur von Köln bis zum Hafen Antwerpen-Brügge in Belgien. Denn eine solche Infrastruktur bildet die Grundlage, um CO₂ zu speichern und so den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren.
Ohne Infrastruktur keine Speicherung oder Nutzung
In der Wissenschaft gilt Kohlenstoffdioxid nicht nur als klimaschädliches Gas, sondern wird immer mehr als wertvoller Rohstoff erkannt. Die Anwendungs- und Umwandlungsmöglichkeiten von CO₂ sind vielfältig, unter anderem könnte es zur Herstellung von Methan, Harnstoff, Synthesegas, Essigsäure, Formaldehyd und Polyolefinen dienen. Bisher ist es jedoch für Unternehmen günstiger, Kohlenstoff aus Rohöl zu beziehen als aus CO₂. „Mit sinkenden Rohöl-Ressourcen und steigender CO₂-Bepreisung wird jedoch die Attraktivität alternativer Lösungen steigen“, erklärt Sebastian Trunk, Projektmanager Standortentwicklung bei YNCORIS. „Bis dahin bietet die Speicherung von Kohlenstoffdioxid beispielsweise in der Nordsee eine Chance, um CO₂-Emissionen zu reduzieren. Doch wie das Kohlenstoffdioxid von den Emittenten zu den Speicherstätten oder später einmal zu potenziellen Nutzern gelangen könnte, wurde bisher nicht in dieser Tiefe und Zusammensetzung untersucht.“
Region mit Potenzial
Das Forschungsunternehmen DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH erhielt daher von Ideengeber YNCORIS GmbH & Co. KG, Industriedienstleister und Betreiber des Chemieparks Knapsack, sowie einem Industriekonsortium den Auftrag zur Studie. Ziel ist es zu klären, ob in der Region die nötige Infrastruktur vorhanden ist oder sinnvoll ergänzt werden kann, um CO₂ zu sammeln, für den Langstreckentransport vorzubereiten und letztendlich grenzüberschreitend zur Speicherstätte zu bringen. Die Studie ist im September 2025 gestartet. Rund sieben Monate wird sich die DBI-Gruppe mit den Möglichkeiten einer regionalen, aber auch grenzüberschreitenden CO₂-Infrastruktur bis nach Belgien befassen. „Dies ist ein ausgesprochen wichtiger Schritt, denn er bildet die Basis für die nachhaltige Produktion bei gleichzeitigem Erhalt existierender Wertschöpfungsketten“, so Trunk. Die Studie wird durch weitere prominente Unternehmen getragen, unter anderem von EEW Energy from Waste GmbH (EEW), Evonik, Fluxys, LyondellBasell, Nippon Gases, OGE, Hafen Antwerpen-Brügge, SEFE und Shell.
Region als Vorreiter
Die Region rund um den Chemiepark Knapsack bietet sehr gute geografische Voraussetzungen für die Studie: Der Petrochemie- und Raffineriestandort Wesseling, in dem Shell und LyondellBasell produzieren und CO₂ ausstoßen, liegt in der Nähe des Chemieparks Knapsack. Am Standort emittiert das Ersatzbrennstoffkraftwerk von EEW Kohlenstoffdioxid sogar zu rund 50 Prozent aus biogenen Quellen. Die beiden Standorte verbinden schon jetzt Trassen und Pipelines. Die Studie wird zeigen, ob sie sich als CO₂-Sammelschiene nutzen oder umwidmen lassen – mit geringen Kosten im Vergleich zu einer neu zu errichtenden Infrastruktur. Die Trassen und Pipelines bilden außerdem die Basis, um den Emittenten aus dem Rheinland eine ausreichende und klimaschonende Speicherung von Kohlendioxid überhaupt erst zu ermöglichen. Hier könnte der Hafen Antwerpen-Brügge mit seinen Plattformen Antwerpen und Zeebrügge als Infrastrukturbetreiber für CO₂-Exitpunkte zu diesen Offshore-Speicherstätten dienen. Mit Evonik und Nippon Gases sind zudem zwei Industriegasnetzbetreiber Teil des Teams. Der deutsche Fernleitungsnetzbetreiber OGE und das belgische Pendant Fluxys könnten den Transport nach beziehungsweise die Verteilung innerhalb von Belgien übernehmen. Fluxys plant zudem mit dem Hafen Antwerpen-Brügge und weiteren Partnern die benötigte CO₂-Infrastruktur in den belgischen Häfen. Das CO₂-Management ist über SEFE möglich. „Somit können wir in der Studie die gesamte CO₂-Wertschöpfungs- oder Entsorgungskette namhaft abdecken und die Studie nicht nur wissenschaftlich, sondern auch mit Industrieexpertise bereichern“, sagt Trunk.
Perspektivisch könnte über die Trassen und Pipelines Kohlenstoffdioxid zu Nutzern transportiert werden, davon ist auch Nicolas Ürlings überzeugt. Der Teamleiter Anlagenwirtschaft YNCORIS entwickelte die Idee gemeinsam mit Trunk. Ürlings ist sich sicher: „CO₂ sollte am besten dort genutzt und umgewandelt werden, wo Energie verfügbar, grün und günstig ist. Denn sowohl die Abscheidung von CO₂ als auch die Umwandlung hin zu Kohlenwasserstoffen ist sehr energieintensiv.“
Frühzeitig agieren
Die Studie schafft wichtige Voraussetzungen, damit sich der Chemiepark Knapsack und die Region zukunftsfähig für eine nachhaltige Speicherung und Nutzung von Kohlenstoffdioxid aufstellen können. Denn selbst bei einer weitgehenden CO₂-Reduzierung, durch Energieeffizienzmaßnahmen, nachhaltigen Wasserstoff und den Einsatz von erneuerbaren Energien werden prozessbedingte CO₂-Emissionen bleiben, beispielsweise aus der Kalk-, Zement- und Stahlproduktion, der Chemie- und Raffinerieproduktion und der thermischen Abfallverwertung. „Die CO₂-Nutzung steckt aus unterschiedlichsten Gründen noch in den Kinderschuhen. Die Herausforderungen werden sich nur durch gemeinsame Anstrengungen von Wirtschaft, Politik, Forschung und Öffentlichkeit überwinden lassen“, ist Trunk überzeugt. „Doch mit der Studie schaffen wir für all diese Bereiche eine belastbare Grundlage, um Treibhausgase zu reduzieren und die weitere Entwicklung in Richtung Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.“